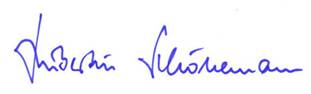Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in vielen Bereichen von Dienstleistung, Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt sich in Deutschland der Mangel an Arbeits-, Fach- und Führungskräften zu einem ernsthaften Problem. Die Kirche bildet da mit ihrem pastoralen Bereich keine Ausnahme. Dabei geht es nicht nur um den starken Rückgang an Priestern, auch die Zahlen der nicht-ordinierten pastoralen Berufsgruppen gehen tendenziell zurück, weil große Jahrgänge demnächst in Ruhestand gehen, immer weniger junge Menschen ein Theologiestudium oder eine kirchliche Ausbildung beginnen. Insgesamt verliert die Kirche massiv an Attraktivität als Arbeitgeber, was nicht nur Säkularisierungsprozessen geschuldet ist, sondern zum großen Teil selbstverursacht ist.
Allerdings spielt neben dem quantitativen Aspekt auch das Qualitative eine zentrale Rolle: Welche Art von pastoraler Hauptberuflichkeit wird in der Kirche von morgen benötigt werden? Wie sind die künftigen Mitarbeitenden in der Pastoral der Kirche motiviert, wie geerdet-theologisch, methodisch-didaktisch, emotional und für ein professionelles system- und rollenbezogenes berufliches Handeln ausgebildet und kompetent?
Und dann kommt noch die Transformation bzw. die Veränderung pastoralen Handelns und kirchlicher Sozialformen hinzu. Es wird immer deutlicher, dass die Frage des Personals und wie es arbeitet sich mit den Bildern und der Praxis von Kirche massiv wandelt. In der Kirche der Zukunft werden sich die Rollen von Hauptberuflichen viel stärker auf die freiwillig engagierten Gläubigen beziehen, die immer stärker das kirchliche Leben vor Ort – auch in Leitungs- und Organisationsaufgaben – tragen und verantworten werden. Von dorther – und von den veränderten sozio-kulturellen und sozialräumlichen Gegebenheiten und Herausforderungen her – werden sie sich und ihre hauptberufliche pastorale Arbeit verstehen und entwerfen müssen. Die Reaktionen darauf sind ambivalent: Manche Mitarbeitende wird man wohl nur schwerlich oder gar nicht mehr mitnehmen können, im fortgeschrittenen Berufsalter noch Neues anzugehen und innovative bzw. andere Formen von Pastoral und Kirche auszuprobieren. Andere „scharren mit den Hufen“ und möchten lieber heute als morgen, dass kirchliche Verantwortungsträger in den Bistumsleitungen den Wandel von den klassischen Pastoralstrukturen hin zu neuen sozialraumorientierten, kategorialen oder passager-resonanten Formen des Kircheseins in Gang bringen.
Nicht nur Personalakquise, sondern auch Einsatzplanung, Aus- und Fortbildung und Personalentwicklung einerseits und kirchliche Organisations-, Struktur- und Pastoralentwicklung andererseits sind zwei Seiten einer Medaille. Zusammen mit der Frage nach Immobilien und Finanzen ist die Frage nach dem haupt- und ehrenamtlichen „Personal“ in der Pastoral eine zentrale Zukunftsfrage, an der sich in den nächsten fünf bis sieben Jahren zeigen wird, wohin die Kirche in Deutschland, die sehr wahrscheinlich auf eine Minderheitensituation zusteuert, und die Diözesen als Träger der verfassten Kirche gehen werden.
In der thematischen Arbeit der KAMP hat die Befassung mit Fragen pastoralen Personals in den letzten Zeiten einen immer größeren Stellenwert erlangt. Wir freuen uns sehr, dass mit dieser Ausgabe von εὐangel Aspekte thematisiert werden, die manche Selbstverständlichkeiten hinterfragen und die Verantwortlichen für Personal- und Pastoralfragen in den Bistümern herausfordern und unterstützen, neue Wege zu gehen und das pastorale Personal mit seinen Berufsbildern, Kompetenzen und Rollen als einen entscheidenden Zukunftsfaktor der Kirche von morgen zu betrachten und zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und fruchtbringende Lektüre, wir freuen uns immer über Reaktionen und Rückmeldungen.
Ihr