Durch Aslan zu Christus?
C. S. Lewis’ Narnia-Geschichten als Ort der Begegnung mit biblischen Themen
Als Weihnachten 2005 der Fantasy-Film „Der König von Narnia“ in die Kinos kam, entstand eine heftige Diskussion: Ist dieser Film nicht, ebenso wie das ihm zugrunde liegende Kinderbuch des Oxforder Literaturwissenschaftlers C. S. Lewis, reinste christliche Propaganda? Dass diese Debatte aufkam, lag nicht zuletzt an der Marketing-Strategie des Disney-Konzerns, die vor allem auf christlich konservative US-Bürger zugeschnitten war. Moderate Stimmen wiesen zwar darauf hin, dass die christlichen Untertöne im Film gegenüber der Buchvorlage abgeschwächt worden seien, Kritiker sprachen hingegen verächtlich von einer „Passion of Christ“ für Kinder. Weltweit wurde der Film ein großer Erfolg (u. a. drei Oscars und Platz 3 auf der Liste der erfolgreichsten Filme 2006), in Deutschland fand er jedoch nur vergleichsweise wenige Zuschauer, wohl auch wegen der negativen Kritik in der deutschen Presse. Ist es überhaupt legitim, die Medien Buch und Film gezielt zu nutzen, um religiöse Überzeugungen publikumswirksam in die Öffentlichkeit zu bringen? In Deutschland ging die Diskussion über diese Frage in die nächste Runde, als 2007 das religionskritische Kinderbuch „Wo geht es bitte zu Gott? fragte das kleine Ferkel“ (von Michael Schmidt-Salomon und Helge Nyncke) erschien, und sie ist bis heute nicht abgeschlossen: Ohne Zweifel kann man diese Medien nutzen, um für die eigenen Glaubensüberzeugungen zu werben – und offenbar darf man es auch, wie die Gerichtsurteile im Fall des „Kleinen Ferkels“ deutlich machen. Ist es aber auch richtig, dies zu tun? Gibt es Kriterien, anhand derer sich eine legitime Nutzung solcher Medien für missionarische Zwecke von unangemessener Propaganda unterscheiden lässt? Ein Blick auf die christlichen Bezüge in den Narnia-Geschichten von C. S. Lewis kann helfen, in dieser Frage etwas mehr Klarheit zu gewinnen; sie sollen daher im Folgenden vorgestellt und analysiert werden.
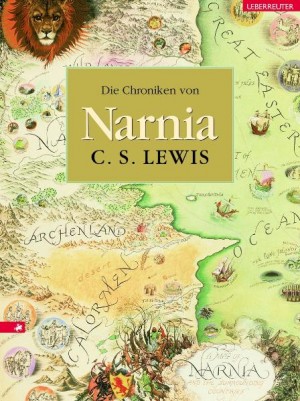
Biblische Bezüge in den Narnia-Geschichten
Ohne Zweifel sind die „Chroniken von Narnia“ (erschienen 1950–1956) mit zahlreichen biblisch-christlichen Themen durchsetzt. Dies zeigt bereits die grobe Handlungsstruktur der sieben Bände: Die Geschichte Narnias beginnt mit der Schöpfung durch den Gesang des Großen Löwen Aslan (der Christus-Figur Narnias, vgl. Offb 5,5); Aslan erscheint dabei auch leibhaftig in seiner Schöpfung (vgl. Joh 1,1–14) und stirbt dort stellvertretend für einen zum Verräter gewordenen Jungen; mit seiner Auferstehung besiegt er den Tod und bringt Narnia die Erlösung von dem Bösen (personifiziert in der Weißen Hexe); das Weltenende bedeutet für die Lebenden wie für die Toten eine (erneute) Begegnung mit Aslan, an dessen Urteil sich ihr Schicksal entscheidet (vgl. Mt 25,31–46). Darüber hinaus finden sich in Narnia etliche weitere Bezüge zu biblischen Themen (insgesamt sicher an die hundert). Zum Beispiel befindet sich im Westen Narnias ein Garten mit einem Baum in der Mitte, von dessen Äpfeln zu essen verboten ist (vgl. Lewis 2005, 62 f., und Gen 1,16f); nach der Schlacht gegen die Weiße Hexe lässt Aslan seine gesamte Gefolgschaft sich im Gras niedersetzen und speist sie auf wunderbare Weise (vgl. ebd. 131 und Mk 6,38–44); dem zu einem Drachen verzauberten Jungen Eustachius gelingt es erst dann, sein Drachen-Dasein zu überwinden, als er bereit ist, in einer Art Taufzeremonie sein Drachen-Selbst (in Form der Drachenhaut) abstreifen und sich durch Aslan neu einkleiden zu lassen (vgl. ebd. 326 f. und Gal 3,27). Und in „Die Reise auf der Morgenröte“ treffen die Reisenden am Rand der Welt auf ein Lamm, das sie mit auf einem Kohlenfeuer zubereiteten Fischen empfängt (vgl. ebd. 369 f. und Joh 21,9). Dieses Lamm, das sich Lucy und Edmund als Aslan zu erkennen gibt, erklärt ihnen, es sei Zeit, in ihre eigene Welt zurückzukehren und diesen dort bei seinem irdischen Namen kennenzulernen.
Weitere literarische Bezüge in den Narnia-Geschichten
Ebenso finden sich in Lewis’ Geschichten aber auch unzählige Bezüge zu anderen Texten der Literaturgeschichte. So fungiert zum Beispiel schon in Edith Nesbits „The Aunt and Amabel“ (1908) ein Kleiderschrank in einem unbenutzten Zimmer als Tür zu einer magischen Welt; dort begegnet einem auch bereits das Spiel mit den Wörtern „wardrobe“ (Kleiderschrank) und „spare room“ (Gästezimmer), auf das Lewis in „Der König von Narnia“ anspielt (vgl. ebd. 78 f.). Zu dem Namen Puddleglum (dt. Trauerpfützler) ließ sich Lewis durch den Ausdruck „Stygian puddle glum“ des englischen Dichters John Studley (ca. 1545–1590) inspirieren. Diese Anspielung gewinnt dadurch noch an Bedeutung, dass „Stygian“ sich auf den Fluss Styx bezieht, der in der griechischen Mythologie die Grenze zur Unterwelt markiert – eben jener Ort, an den sich Puddleglum in „Der silberne Sessel“ begibt. Dabei kann dieses Buch auch insgesamt als Lewis’ Version von Platons Höhlengleichnis gelesen werden. In „Das Wunder von Narnia“ vertreten Onkel Andrew und die Hexe Jadis exakt dieselbe Ansicht wie Raskolnikow in Dostojewskis „Schuld und Sühne“ (1866), wenn sie behaupten, sie stünden als herausragende Persönlichkeiten über den Regeln der gewöhnlichen Moral; deshalb sei ihnen auch alles erlaubt, was ihren Zwecken diene – selbst Mord (vgl. ebd. 15–17; 30). Die Liste solcher Anspielungen auf Texte von der Antike bis zur Gegenwart ließe sich nahezu beliebig verlängern, dazu kommen noch die aus der Fabelwelt bekannten sprechenden Tiere und eine ganze Schar mythologischer Figuren wie Faune, Zwerge, Hexen, Riesen, Zentauren, Nymphen, Dryaden, Bacchus – und der Weihnachtsmann.
Christliche Propaganda oder heidnischer Mythenzoo?
Bereits den ersten Lesern fielen die biblisch-christlichen Bezüge in den Narnia-Geschichten auf, und schon früh entstand auch der Vorwurf, Lewis habe mit ihnen Propaganda für das Christentum betreiben wollen (bzw. sie seien bloße Allegorien auf das christliche Erlösungsgeschehen). Einige christliche Leser hingegen finden die Bezüge zur Mythologie (der Spiegel spricht in seiner Filmrezension zu „Der König von Narnia“ sogar von einem „heidnischen Mythenzoo“) so irritierend, dass sie diesen Geschichten bis heute mit großen Vorbehalten begegnen. Und sie bemängeln das Ausbleiben eben dessen, was die Chroniken von Narnia nach ihrer Ansicht zu einem wahrhaft christlichen Werk machen würde: Unter all den biblischen Anspielungen findet sich keine einzige, die eine Eins-zu-eins-Übersetzung in einen biblischen Kontext erlauben würde. Lewis’ Bücher, so befindet Peter Hasenberg, der Filmbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, seien daher auch keineswegs das Neue Testament als Märchen: Um als in Fantasy gekleidetes „Lehrwerk“ über den christlichen Glauben gelten zu können, seien sie viel zu heidnisch (vgl. Hasenberg 2006, 96). Dieselbe Vielfalt an literarischen Bezügen findet sich übrigens auch in Lewis’ phantastischer „Perelandra“-Trilogie für Erwachsene (erschienen 1938–1945). Bei der Charakterisierung der Planeten Mars und Venus orientiert Lewis sich hier zum Beispiel an den Vorstellungen der antiken Kosmologie: Der Mars wird als männlicher Planet präsentiert, die Venus als weiblich. Das Thema des zweiten Bandes ist jedoch der biblische Sündenfall – der freilich auf Perelandra (= Venus) abgewendet werden kann. Der Planet erscheint dem irdischen Besucher Ransom aber zeitweise wie der Garten der Hesperiden, ja er fragt sich sogar ausdrücklich, ob nicht all das, was auf der Erde als bloße Mythen erscheint (dem Original der Zyklopen war er auf dem Mars begegnet), in anderen Welten als Realität existiert (vgl. Lewis 2000, 255). Direkte literarische Anspielungen finden sich in „Perelandra“ zum Beispiel auf Virgil, Dante und Milton, aber auch auf die Bibel. So formuliert die „Green Lady“ (die Eva-Figur Perelandras) einen Lobpreis auf ihren Schöpfer Maleldil (= Gott), der starke Anklänge an das Magnificat hat: „Doch mein Geist preist Maleldil, der aus den Himmelstiefen in diese Niedrigkeit herabsteigt und machen wird, daß alle Zeiten, die uns entgegenrollen, mich segnen werden“ (ebd. 281). Auch hier scheitern viele Deutungsversuche der Geschichten daran, dass sie mit jeweils einem Teil dieser Anspielungen nichts anfangen können: Die biblisch-christlichen Bezüge sind zweifellos vorhanden, die Bezüge zur Mythologie (bzw. zur abendländischen Literaturgeschichte insgesamt) aber auch.
Die Narnia-Geschichten als fairy tales
Gibt es vielleicht noch eine andere Deutungsmöglichkeit für Lewis’ Geschichten, jenseits der vermeintlichen Alternativen „heidnischer Mythenzoo“ und „christliche Propaganda“? Als Ansatzpunkt für die Suche nach einer solchen Deutungsmöglichkeit können Lewis’ eigene Äußerungen zur Entstehung der „Chroniken von Narnia“ dienen. Diese Äußerungen entstanden in Reaktion auf die Vermutung einiger Leser, am Anfang seiner Geschichten habe die Frage gestanden, wie es möglich sei, christliche Themen für Kinder aufzubereiten. Dafür habe er dann die fairy tale (= phantastische Geschichte bzw. Märchen für Kinder) als Form gewählt, er habe begonnen, Informationen über die Psychologie von Kindern zu sammeln, eine Altersgruppe festgelegt, eine Liste von Themen erstellt, die er allegorisch behandeln wolle usw. (vgl. Lewis 1982, 46). Lewis erklärt, auf diese Weise zu schreiben sei ihm völlig unmöglich, nahezu das Gegenteil sei tatsächlich der Fall gewesen: Am Anfang sämtlicher Geschichten standen Bilder in seinem Kopf, etwa ein Faun, der einen Regenschirm trägt, eine Königin auf einem Schlitten oder ein großartiger Löwe, und diese Bilder hätten sich dann von selbst zu einer Folge von Ereignissen – zu einer Geschichte – verdichtet. Zu Beginn habe die Welt von Narnia daher auch gar nichts spezifisch Christliches an sich gehabt, dies sei erst später und ohne sein ausdrückliches Zutun von selbst hineingekommen. Die fairy tale erschien Lewis dabei als die passende literarische Form für seine Geschichten, weil er sie nicht nur in ihrer Schlichtheit und Kürze, sondern auch in ihrem Widerstand gegen logische (und psychologische) Analysen besonders schätzte (vgl. ebd.).
Ihren Widerstand gegen die (in der Allegorie gerade angezielte) Möglichkeit einer Eins-zu-eins-Übersetzung der Bilder und Szenen in abstrakte philosophische oder theologische Begriffe teilt die fairy tale dabei nach Lewis’ Ansicht mit den antiken Mythen (und vielen zeitgenössischen phantastischen Geschichten). Am Beispiel des Mythos von Ödipus, der bei seinem Versuch, der Prophezeiung des Orakels zu entfliehen, gerade diese erfüllt (Ödipus tötet seinen Vater und heiratet seine Mutter), erklärt er: Wer eine solche Geschichte liest, erfährt etwas, das, obwohl verwirrend für den Verstand, dennoch als zutiefst wahr empfunden wird: Vorherbestimmung und Freiheit gehen, auch wenn sie einander theoretisch widersprechen, miteinander Hand in Hand – ja, der Vollzug des freien Willens trägt sogar entscheidend dazu bei, dass ein Mensch dem ihm vorherbestimmten Pfad folgt. Geschichten mit dem Charakter der fairy tale mögen daher zwar auf der Oberfläche nicht wie das „wirkliche Leben“ sein, aber sie präsentieren nach Lewis’ Überzeugung ihren Lesern ein Bild dessen, worum es im menschlichen Leben eigentlich geht. Ihr Realismus liegt also nicht auf der Außenseite, sondern im Inneren des Menschen: Es sind die Gesetzmäßigkeiten der geistigen Welt, die in ihnen zum Ausdruck kommen (vgl. Lewis 1982, 12–15). Dass Geschichten wie fairy tales, Märchen, Sagen oder Mythen zu seiner Zeit fast nur noch von Kindern gelesen wurden, hielt Lewis dabei für eine historische Ausnahme: Früher seien solche Geschichten auch von Erwachsenen gelesen worden, weil sie sich auf jenen gemeinsamen universell menschlichen Boden beziehen, den Erwachsene mit den Kindern teilen (vgl. ebd. 50 f.). Um eben diese gemeinsame Dimension allen Menschseins geht es Lewis mit seinen Narnia-Geschichten, ihre Themen sind daher die großen Menschheitsfragen von Sinn und Sinnlosigkeit, Hoffnung und Enttäuschung, Gut und Böse, Freiheit und Destination, Schuld und Vergebung, Zeit und Ewigkeit, Schmerz und Leid, Tod und Auferstehung (all diese Themen kommen in den sieben vergleichsweise kurzen Bänden zur Sprache).
Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht: Die Frage nach Gut und Böse bzw. nach dem richtigen Tun ist ohne Zweifel eines der zentralen Themen der fairy tale (man denke z. B. an die Märchen der Gebrüder Grimm). Dies lassen auch bereits die ersten Seiten von „Der König von Narnia“ erkennen (erschienen als der erste Band der Serie). Lucy, das jüngste der vier Pevensie-Kinder, wird als ein wahrhaftiges, kluges, tugendhaftes Mädchen eingeführt: Sie ist anderen gegenüber stets aufrichtig, und sie ist auch klug genug, um darauf zu achten, dass sich die Tür des Kleiderschranks nicht ganz hinter ihr schließt, als sie in ihn hineinschlüpft. Ihr Bruder Edmund hingegen ist ein schwacher, aufmüpfiger, selbstbezogener Charakter: Er tut sich schwer, die Autorität seiner beiden älteren Geschwister anzuerkennen, und er lässt sich auch mehrfach zu Gemeinheiten gegenüber Lucy hinreißen. (Die Tür des Kleiderschranks schließt er hinter sich, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, was dies für Konsequenzen haben könnte.) Was dies für Folgen hat, zeigt sich bereits in den ersten Begegnungen, die beide Kinder beim Betreten der neuen Welt haben: Lucy trifft auf den Faun Tumnus und kann ihn, der gerade dabei ist, sie zu verraten und an die böse Hexe auszuliefern, durch ihre Aufrichtigkeit und Güte dazu bringen, von seinem falschen Tun abzulassen. Edmund hingegen lässt sich durch seine geradezu suchtartige Gier nach Türkischem Honig und das falsche Versprechen der Hexe, er werde seinen Geschwistern vorgezogen (und zum alleinigen König Narnias gemacht), dazu hinreißen, seine Geschwister zu verraten und an die Hexe auszuliefern. Es ist offensichtlich, dass Lewis diese Parallelität in der Entscheidung für Gut und Böse ganz bewusst an den Anfang seiner Geschichte gestellt hat. Wer jetzt noch Zweifel hat am Charakter dieses Buches und der in ihm vorkommenden Figuren, dem hilft wohl nur noch der Hinweis auf seine ersten Worte: „Es waren einmal vier Kinder …“
Christus und Mythos: keine Gegensätze
Dass Lewis bei der Darstellung seiner Figuren und Themen nicht nur aus der biblisch-christlichen Tradition schöpfte, geschah dabei ganz bewusst: Lewis wusste, so bemerkt der Spiegel in seiner Rezension zu „Der König von Narnia“, „dass die zentralen Texte der europäischen Kultur die Bibel und die griechischen Sagen sind“ (Haas 2005). Dies trifft im Kern zu, wäre aber noch zu erweitern: Die Narnia-Geschichten sind eine bunte Mischung aus Bibel, heidnischer Legende, Märchen, mittelalterlichem Epos, Mythos und Parabel – das einzige, was hier vielleicht noch fehlt, ist ein Hobbit (so meint zumindest die britische BBC News). Die gesamte Literaturgeschichte des Abendlandes bot Lewis Material für seine Themen, und wo immer ihm eine Anspielung oder ein Bezug passend erschien (d. h. geeignet schien, bei der Ausgestaltung einer Szene zu helfen), baute er diese(n) mit ein. Dabei achtete er allerdings darauf, dass die Geschichten auch ohne eine Wahrnehmung dieser Bezüge oder Anspielungen verständlich blieben: Andernfalls hätte er riskiert, von vielen seiner (ja oft sehr jungen) Leserinnen und Leser nicht verstanden zu werden. Die Narnia-Geschichten funktionieren daher auch als Geschichten – unabhängig davon, ob man die biblischen, mythologischen oder literaturgeschichtlichen Anspielungen und Bezüge in ihnen entdeckt oder nicht. Wer in Narnia keine biblischen Bezüge entdeckt (oder sich nicht für diese interessiert), der hat daher nach Lewis’ Ansicht auch nichts falsch gemacht: Er liest diese Geschichten nur auf einer anderen Ebene. Tatsächlich nehmen viele Leser die christlichen Bezüge auch erst nachträglich wahr – wenn man sie darauf aufmerksam macht: Bei der Lektüre selbst fallen sie (auch theologisch gebildeten Lesern) oft gar nicht auf. Es gibt aber noch einen tieferen Grund, weshalb Lewis bei der Ausgestaltung seiner fairy tales nicht nur auf christliche Quellen zurückgriff: Lewis sah keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen heidnischer Mythologie und dem christlichen Erlösungsgeschehen. Ihm selbst war es nicht zuletzt deshalb möglich geworden, als Erwachsener zum christlichen Glauben zurückzukehren, weil er erkannte, dass ein Motiv, das in vielen Mythen vorkommt (Balder, Adonis, Osiris), in Christus historisch verbürgte Realität geworden ist: ein Gott, der stirbt und wieder aufersteht, um der Welt neues Leben zu bringen. Diese Mythen hatten nach Lewis’ Ansicht also recht, wenn sie die Erlösung einer in Leid, Schuld und Tod verstrickten Welt mit einem stellvertretenden Sterben Gottes selbst in Verbindung brachten. Was ihre Autoren freilich nicht ahnten, ist, dass das, was sie als ein mythisches, d. h. sich im jährlichen Wechsel der Jahreszeiten weltweit wiederholendes Geschehen darstellten, unter Pontius Pilatus einmal ein Ereignis der realen Weltgeschichte werden würde: Der alte Mythos vom sterbenden Gott wurde ein historisches Faktum, so formuliert Lewis diese Erkenntnis in einem seiner Essays. In Übereinstimmung hiermit präsentiert Lewis den Opfertod Aslans in Narnia ebenfalls als ein reales geschichtliches Ereignis, Aslan stirbt jedoch nicht am Kreuz, sondern auf einem steinernen Tisch, der ganz nach dem Vorbild antiker Opferaltäre gestaltet ist. Das Zerbrechen dieses Tisches nach dem Vollzug des Opfers (in Narnia ein Vorrecht der Weißen Hexe) macht allerdings deutlich, dass mit dem stellvertretenden Sterben Aslans der Opferkult ein für alle Mal zu Ende ist: Die tötende Macht, die das Gesetz über jene hat, die es übertreten (so steht es auf dem Stein des Tisches selbst geschrieben; vgl. Lewis 2005, 118, und 2 Kor 3,7), ist überwunden, erneute Opfer sind nicht mehr nötig.
Wie hätte Christus in Narnia gehandelt?
Dies ist natürlich eine christliche Sichtweise, und Lewis ist sich dessen auch bewusst. Er bestreitet aber, dass er es von Anfang an auf eine christliche Moral angelegt habe. Mit einer solchen Absicht an das Schreiben von Geschichten für Kinder heranzugehen bringt nach seiner Überzeugung keine guten Geschichten hervor: Wesentlich besser sei es, wenn der Autor die sich zu Handlungsmustern verdichtenden Bilder in seinem Kopf ihre eigene Moral erzählen lasse. Diese Moral sei dann nämlich kein bloßes Kopfprodukt, sondern sie speise sich aus den spirituellen Wurzeln, die sich ein Autor während seines gesamten Lebens zu eigen gemacht hat (vgl. Lewis 1982, 41). Lewis meint, gerade Kinder seien sehr sensibel für diesen Unterschied: Sie würden schnell merken, ob sich eine Moral organisch aus der Handlung einer Geschichte ergibt oder ob sie dieser von außen aufgezwungen wurde. In seinen eigenen Geschichten habe die christliche Moral daher auch nicht am Anfang gestanden, sondern es sei Aslan selbst gewesen, der sich im Prozess des Schreibens immer mehr als die Erlöserfigur Narnias zu verhalten begann. Diese zunehmende Nähe Aslans zu Christus sei ihm dann allerdings selbst bewusst geworden, und dies habe ihn auf die Frage gebracht: Angenommen, es gibt eine Welt wie Narnia, auch sie ist eine gute Schöpfung Gottes und in Narnia bricht ebenfalls das Böse ein, wie würde Gott dann hier handeln – in und durch Aslan? Lewis beschreibt dies als ein Spiel mit dem menschlichen Vorstellungsvermögen, nicht aber als eine rein verstandesmäßige Suche nach Parallelen zwischen Aslan und Christus. Eine Eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen diesen beiden ist also gar nicht angezielt, daher fehlen in Narnia auch ganze Bereiche der Theologie (so gibt es dort z. B. weder die Institution Kirche noch Gottesdienste oder gar Sakramente). In seinem Versuch einer Klärung der eigenen Absichten beim Schreiben unterscheidet Lewis sein Vorgehen als Autor, der sich um das Schreiben guter, in sich stimmiger Geschichten bemüht, von der Person C. S. Lewis, die mit den von ihr als Autor verfassten Geschichten bestimmte Absichten verbindet. Als diese Person, so erklärt er, nahm er natürlich auch die Möglichkeit wahr, mit diesen Geschichten seine Leserinnen und Leser an die Botschaft des Evangeliums heranzuführen. Das heißt, er sah, dass er mit diesen Geschichten eine Schwierigkeit umgehen könnte, die viele seiner Zeitgenossen davon abhielt, den befreienden Charakter der biblischen Botschaft wahrzunehmen. Allzu oft stand dem ein stark moralisierender Umgang mit dieser Botschaft entgegen: Als Kind, so berichtet Lewis, hatte ihm die ständig wiederholte Forderung, Gott dankbar sein zu müssen für seine Rettung durch und in Jesus Christus, es völlig unmöglich gemacht, eben diese Dankbarkeit und Liebe Christus gegenüber tatsächlich zu verspüren (vgl. Lewis 1982, 47). Was aber, wenn es gelingen würde, die biblische Botschaft von diesen moralisierenden Assoziationen zu befreien, indem man ihre zentralen Themen in einer fairy tale präsentiert? Wäre es dann nicht möglich, die Leser einer solchen Geschichte den Sinn des biblischen Erlösungsgeschehens in seiner wahren Größe und Kraft erfahren zu lassen – ohne dass dabei die bekannten negativen Gefühle hochkommen? Genau so war es Lewis selbst gegangen, als er als Jugendlicher die heidnischen Mythen von sterbenden und zu neuem Leben auferstehenden Gottheiten gelesen hatte: Ihren tiefen Sinn hatte er beim Lesen verspürt, auch wenn er noch nicht bereit war, Tod und Auferstehung Jesu als historische Tatsachen anzuerkennen. Lewis’ Ziel ist also nicht die Indoktrination seiner Leserinnen und Leser mit christlichen Glaubensinhalten (und auch kein manipulatives Umgehen des Verstandes), sondern eine Hilfe zum Verständnis der biblischen Botschaft: Nur wer die Relevanz der biblischen Glaubensaussagen für sein eigenes Leben entdeckt (wer versteht, was es bedeuten würde, falls sie wahr sind), kann nach Lewis’ Überzeugung überhaupt die Frage nach ihrer Wahrheit richtig stellen.
Die Chroniken von Narnia als praeparatio evangelica
Zur Entdeckung dieser Lebensrelevanz der biblischen Glaubensaussagen können die Narnia-Geschichten in der Tat auch heute noch beitragen, nicht zuletzt deshalb, weil das Christentum (wie das Judentum) eine geschichtliche Religion ist: Es basiert auf der Geschichte Gottes mit seinem Volk, die in Leben, Tod und Auferstehung Jesu von Nazareth ihren Höhepunkt gefunden hat. Die mythologischen bzw. phantastischen Bezüge Narnias stehen dabei einer solchen Entdeckung keineswegs im Weg: Sie sind ein integrativer Bestandteil der literarischen Gattung der fairy tale (die magischen Elemente in ihnen wollen also keineswegs realistisch verstanden werden), außerdem sind sie ein Ausdruck von Lewis’ inklusivem Verständnis des Christentums im Verhältnis zu anderen Religionen und Glaubensrichtungen. Eine solche Nutzung literarischer Texte im Sinne einer praeparatio evangelica erscheint insofern legitim, als sie ihre Leser voll und ganz ernst nimmt: Lewis’ Geschichten geben nicht vor, etwas zu sein, das sie nicht sind, um dann versteckt (oder ganz offen) Propaganda für das Christentum zu betreiben. Sie sind geschrieben als fairy tales und wollen auch als solche gelesen werden; die Freiheit, die biblisch-christlichen Bezüge in ihnen herauszuhören (oder auch zu überhören), verbleibt beim Leser. Damit können die Bücher von Lewis aber auch für Nichtchristen zu einer interessanten Lektüre werden: Ihnen kann etwas gelingen, was den biblischen Texten aufgrund ihrer Vorbelastung (die oft ein genaueres Hinsehen verhindert) heute nur noch selten gelingt: Sie können ihre Leser an die biblische Vorstellungswelt heranführen, und sie können ihnen auch ein Stück weit erfahrbar machen, dass die christlichen Antworten auf die großen Fragen der Menschheit gute, auch heute noch stimmige, weil lebenstaugliche Antworten sind. Gelingt ihnen dies, so kann es sein, dass ein Leser, der die Spuren Aslans in Narnia verfolgt, auch die Spuren Jesu in unserer Welt wieder etwas deutlicher wahrnehmen kann als zuvor. Gelingen wird die Entdeckung der Lebensrelevanz dieser Geschichten freilich nur dann, wenn man sich auf sie einlässt – wenn man in ihnen also mehr bzw. anderes sieht als vermeintliche Allegorien oder christliche Propaganda. Ihre Überzeugungskraft liegt daher auch nicht in einer vordergründigen Rhetorik oder der Verunglimpfung anderer Glaubensüberzeugungen (wie es hier um das „Kleine Ferkel“ steht, mag jede/r für sich selbst entscheiden), sondern steht und fällt mit ihrer Fähigkeit, als Geschichten zu überzeugen. Entsprechend reißen die Chroniken von Narnia auch die gängigen Fronten ein: Es gibt Christen, die mit ihnen nichts anfangen können, aber auch Atheisten, die bekennen, wie sehr sie von den spirituellen Einsichten dieser Bücher profitiert hätten. Lewis selbst war übrigens in dieser Hinsicht um einiges toleranter als mancher seiner heutigen Kritiker. So lehnte er zum Beispiel die in David Lindsays Science-Fiction-Roman „Voyage to Arcturus“ (1930) zum Ausdruck kommende gnostisch-manichäische Grundhaltung ab, anerkannte aber ausdrücklich die Qualität dieses Buches als fairy tale. Dessen Planet „Tormance“ sei, so schreibt er, nicht einfach geographisch eine andere Welt, sondern konzipiert als eine Region des Geistes (vgl. Lewis 1982, 11 f.). Lewis bestätigte Lindsay also, die richtige Art von Literatur geschrieben zu haben, auch wenn er der darin zum Ausdruck gebrachten Lebenshaltung selbst nicht zustimmen konnte. Daher empfahl er „Voyage to Arcturus“ auch immer wieder zur Lektüre. Dieselbe Offenheit gegenüber den Geschichten anderer, selbst wenn sie nicht die eigenen Überzeugungen zum Ausdruck bringen, würde man heute auch manchem Kritiker der Chroniken von Narnia wünschen.
